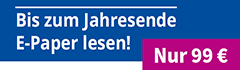Hildegard Biehl-Höchst, Wildpflanzenpädagogin und Biosphärenguide hatte in Kooperation mit dem Förster Matthias Schmiederer vom Forstrevier Todtnau zur Führung durch den Wald bei Fröhnd eingeladen. Die Veranstaltung richtete sich an Menschen, die den Wald und seine Bäume besser verstehen wollen.
Natur: Biosphärenguide und Förster bringen Besuchern bei Begehung den heimischen Wald näher
Von Gudrun Gehr
Fröhnd. Zum Treffpunkt bei der Fröhnder Brücke in Unterkastel trafen sich zehn interessierte Besucher, die die Veranstalterin begrüßte: „Jeder hat wohl über Förster Peter Wohllebens Bücher gehört, nun können Sie sich ein eigenes Bild machen.“ Die zehn Besucher stellten sich gegenseitig vor, darunter der Erbe eines Waldstückes, an der Umwelt und Klimaveränderung Interessierte oder Besucher, die bereits andere Waldführungen der Naturführerin erlebt hatten. Ebenfalls kam zur Führung als Besucher ein exzellenter Kenner des Fröhnder Waldgebietes: der Altbürgermeister von Fröhnd und langjährige Weide-Inspektor Albert Kiefer. Gemeinsam begab man sich auf eine vierstündige Begehung des Waldes, mit individuellen Stopps bei den verschiedenen Waldtypen, in Gebieten von Jungpflanzen und des Altbestandes, in den Lebensräumen der Vögel und der Waldtiere oder bei der Erörterung einer naturnahen Waldwirtschaft und ihrer typischen Pflanzen.
Allmendweiden aus der Not geboren
Im Vordergrund der Führung stand die Frage, ob der Wald Retter oder Opfer bei der Klimaveränderung sei. Brauchen wir mehr Wald oder weniger? Die Naturführerin begleitete ihre Gäste mit Förster Matthias Schmiederer auf dem Weg in Richtung Ittenschwand, in früheren Zeiten als „Kirchweg“ in die Schönauer Kirche benutzt. Die Naturführerin beschrieb die abwechslungsreiche Landschaft: „Hier herrscht eine grünlandreiche Waldlandschaft vor, hier ist ein kleinräumiger Wechsel zwischen Wald und Weide, die auch eine große Artenvielfalt mit sich bringt.“ Eine Besonderheit der Fröhnder Landschaft sind die gemeinschaftlichen Allmendweiden. Dies war immer mageres Weideland mit besonderer Artenvielfalt, deshalb seien die Weiden heute auch so wertvoll.
Die Naturführerin ergänzte: „Die Allmendweiden waren nie in der Nähe des Dorfes, sie waren immer ganz oben, oder ganz hinten.“ Allmendweiden würde man an der bräunlichen Farbe erkennen, dorfnahe Mähwiesen seien infolge besserer Düngung grüner. Felder in Dorfnähe bezeichnete man als „zahmes Feld“ , Allmendweiden waren das „wilde Feld“ . Ex-Bürgermeister Kiefer ergänzte: „Die Gemeinde Fröhnd ist 1620 Hektar groß, hiervon sind 450 Hektar Allmendflächen.“ Die Landwirte hatten wenig eigene Flächen, sie waren auf die Allmendflächen angewiesen.
Fröhnd würde in einer naturverträglichen Entwicklungszone der Modellregion Biosphärengebiet liegen. Die Fröhnder seien, bedingt durch die Erbteilung, oft im Besitz von kleinteiligen Ackern gewesen. Daher waren die Allmendflächen von großer Wichtigkeit für die früheren Landwirte.
Müll verschandelt Vegetation
Die üblichen glucksenden Quellgeräusche der Quelle in Richtung Fröhnd waren aufgrund der Wasserknappheit nicht hörbar. Naturführerin Biehl-Höchst erklärte den Baumbestand mit Fichten, Buchen, Bergahorn und Eschen anhand des Laubs. Teilnehmer Bernhard stellte schmunzelnd fest, dass auch Tetrapack-(Laub)-Teile auf dem Boden liegen, verantwortungslos von einem Waldnutzer liegengelassen, und sammelte die Hinterlassenschaft in seine mitgebrachte Mülltüte ein. Im Gebiet der „Duhle“, einer ehemaligen beweideten Fläche, konnte ein sich neu bildender Sukzessionswald beobachtet werden. Auch Neophyten wie die kanadische Goldrute oder das indische Springkraut befinden sich auf der ehemaligen Weidefläche. Deren Samen mit Nussgeschmack ist gut genießbar. Problematisch ist die Verbreitung des Adlerfarns, welchen sogar Ziegen verschmähen. Weiter ging es zu Mischwäldern oder „Urwald“-Gebieten, die seit Jahrzehnten unbewirtschaftet sind.
Fichten zum Wiederbewalden
Schnellwachsende Fichten wurden in Notzeiten, unter anderem nach dem zweiten Weltkrieg, angepflanzt. Diese wehrt sich durch Harzbildung gegen Schädlingsbefall, bei Trockenzeiten wird der Abwehrmechanismus geschwächt, und es findet der Borkenkäfer Zugang. Monokulturen von Fichten seien ideal für Schädlingsbefall, besonders klimaverträglich der „Plenterwald“ mit einer Mischung von Fichte, Buche und Weißtanne in einem sich stetig verjüngenden Dauerwald. Der „Plenterwald“ sei auch der wirtschaftlichste Wald. Weitere Themen waren die naturnahe Waldwirtschaft und CO2-Bindung im Holz. Als Fazit wurde festgestellt: Der Wald ist ein sehr kompliziertes und empfindliches Öko-System.
Meist geklickt
Beilagen
Umfrage