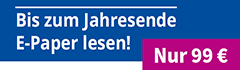Lörrach - Die „Riehener Gedenkstätte für Flüchtlinge zur Zeit des 2. Weltkriegs“ ist der einzige Schweizer Ort, der sich dem Thema Flucht in die Schweiz zu dieser Zeit widmet – und hat nach den Worten des Gedenkstättengründers Johannes Czwalina nicht immer einen leichten Stand.
Lesung: Publikation über Flucht- und Weltkriegsschicksale im Dreiländereck.
Keine Anklagestätte
„Eine Gedenkstätte wird schnell als Anklagestätte verstanden, die zu dem schönen Ort nicht passt“, so Czwalina, der diesen Ort der Erinnerung 2011 in einem alten Bahnwärterhäuschen eingerichtet hat. Dabei geht es Czwalina nicht um Anklage. „Durch die Aufarbeitung der Vergangenheit erlangen wir Weisheit für die Gegenwart“, betonte der Unternehmensberater und frühere Pfarrer am Dienstagabend im Dreiländermuseum.
Im voll besetzten Hebelsaal lasen er und sein jüdischer Mitarbeiter Dan Shambicco aus dem Buch „Nie geht es nur um Vergangenheit“, das die beiden zusammen mit dem früheren Leiter des Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung, Wolfgang Benz, herausgegeben haben.
Zeitzeugenberichte
Darin lassen sie – teilweise nur unter Nennung der Namensinitialen – Zeitzeugen sowie Nachkommen von Opfern und Tätern zu Wort kommen, die sie selbst interviewt haben. Drei Zeitzeugenberichte stellten Czwalina und Shambicco ihrem Publikum vor: Shambicco las aus den Erinnerungen der 1932 geborenen W.W., die als Kind eines nationalsozialistisch gesinnten Vaters der Basler Hitlerjugend angehörte und an Jugendlagern und Aufmärschen teilgenommen hatte. W.W. konnte nach dem Krieg mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern in Basel bleiben, während ihr Vater nach Deutschland ausgewiesen wurde.
Dann erzählte Czwalina von seiner Begegnung mit den Gebrüdern Munz, die ihre Kindheit in besagtem Bahnwärterhäuschen verbracht hatten. An diesem Haus fuhr das einzige Riehener Polizeiauto täglich mit aufgegriffenen Flüchtlingen vorbei. Die Fahrt ging an die Grenze, wo die Menschen an die deutsche Polizei ausgeliefert wurden, was häufig einem Todesurteil gleichkam.
Manche Flucht gelang
Doch so manche Flucht glückte auch. So konnte sich ein Teil der jüdischen Familie Bodenheimer mit Hilfe der Stettener Familie M. der Verfolgung entziehen. R.M., die Tochter der Familie und Zeitzeugin, berichtete am Ende der Lesung persönlich von der Trennung von ihrem Vater A.M., der den Bodenheimers falsche Papiere besorgt hatte.
Als Schweizer Armeeangehöriger durfte er Lörrach lange Zeit nicht betreten. Nur ein oder zwei Mal jährlich habe sie ihrem Vater an der Grenze aus rund 40 Metern Entfernung zuwinken können.
„Auch nach dem Krieg durfte mein Vater nicht gleich über die Grenze“, so R.M. Die Grenze blieb geschlossen – und wurde erst zum Hebeltag am 10. Mai 1947 erstmals wieder für Schweizer Besucher geöffnet.
Meist geklickt
Beilagen
Umfrage