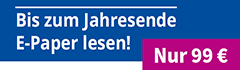Im Mittelpunkt einer zweitägigen Veranstaltung zum Thema Wolf im Kurhaus Schluchsee standen die Auswirkungen für die Weidewirtschaft. Hierzu waren Fachleute des Umweltministeriums, des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV), der Forstlichen Versuchsanstalt Baden-Württemberg (FVA) sowie die Erzeugergemeinschaft Schwarzwald Bio-Weiderind (EZG) vor Ort. Die drei Projektpartner gehen ein Bündnis für den Herdenschutz ein, um Tierhalter und die Landwirte zu unterstützen.
Die Ansiedlung des Wolfes stellt die Weidetierhaltung vor Herausforderungen
Nicht absehbare Wendung
Initiiert wurde dieser Zusammenschluss als Ergebnis einer Veranstaltung im Jahr 2021, ebenfalls in Schluchsee. Dass ausgerechnet in dieser Region der Wolfsrüde GW 1129m für die ersten Risse an Rindern im Land verantwortlich sein würde, war damals nicht vorhersehbar – ebenso wenig, dass sich in unmittelbarer Nähe ein mutmaßliches Wolfspaar nachweisen lässt.
Im Südschwarzwald werden in den kommenden vier Jahren bei zehn Pilotbetrieben präventive Herdenschutzmaßnahmen erprobt, wobei auf individuelle Lösungen gesetzt wird, wie mitgeteilt wird.
Im Südschwarzwald
„Die Landwirtschaft mit Rindern, Ziegen und Schafen auf dem Grünland wird im Südschwarzwald gebraucht, um die Ziele der Offenhaltung, der Artenvielfalt und der Nahrungsmittelversorgung erreichen zu können. Deshalb müssen Landwirte umfangreiche Unterstützung erhalten – finanziell und emotional“, sagte Landrätin und Naturpark-Vorsitzende Marion Dammann. Der Naturpark habe es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, relevante Akteure zusammenzubringen.
Bernhard Bolkart vom BLHV weiß um die Hürden, die sich für die Weidetierhalter ergeben: „Wir als berufsständische Vertretung müssen immer wieder feststellen, dass es gerade beim Zaunbau zu Problemen bei der Genehmigung und Förderung kommt.“
Markus Kaiser von der Erzeugergemeinschaft Schwarzwald Bio-Weiderind betonte, dass die schnelle Umsetzung von Schutzmaßnahmen nicht am Willen der Weidetierhalter scheitere. Vielmehr spielten neben topografischen, administrativen und finanziellen Fragen beispielsweise auch Überlegungen zur Wasserversorgung der Tiere, touristische Ansprüche sowie Belange der Gemeinden mit hinein.
Karl-Heinz Lieber, Abteilungsleiter Naturschutz des Umweltministeriums, welches das Projekt finanziert, sprach in Bezug auf die nötigen Maßnahmen von einem „zielorientierten Pragmatismus“. Grundlage für den Umgang mit dem Wolf seien die rechtlichen Rahmenbedingungen, die ihm aktuell einen starken Schutzstatus gewährten.
Dennoch sieht Lieber den besonderen Stellenwert in der Beweidung, wie sie im Südschwarzwald praktiziert wird und versichert: „Wir kümmern uns um die Offenhaltung der Kulturlandschaft.“
Der vollumfängliche wolfsabweisende Herdenschutz durch Zäune sei in der Rinderhaltung im Schwarzwald kaum realisierbar. Vielmehr ginge es darum, was den Betrieben zumutbar sei, wurde klar gestellt. Erst wenn die „zumutbaren Herdenschutzmaßnahmen“ verlässlich definiert und umgesetzt seien, könne man auf eine Ausnahmegenehmigung hinwirken, falls diese wiederholt von einem Wolf überwunden werden sollten.
Die FVA wertet das Auftauchen eines weiblichen Wolfes und folglich auch die Paar- und Rudelbildung aus ökologischer Sicht als erwartbares Szenario für viele Gebiete in Baden-Württemberg. Die Umsetzung präventiver Herdenschutzmaßnahmen sei deshalb unabhängig vom aktuellen Vorkommen der Wölfe. Im Naturparkgebiet leben derzeit zwei Wölfe dauerhaft – je ein männliches Tier in den Regionen Schluchsee und Feldberg.
Insbesondere Schafe und Ziegen bedürften eines Schutzes vor Übergriffen. Für sie wurden sogenannte Fördergebiete zur Wolfsprävention eingerichtet. Wölfe seien jedoch auch in der Lage, ausgewachsene Rinder anzugreifen – wie jüngst erstmals geschehen. Vornehmlich reißen Wölfe Wildtiere wie Rehe, Rothirsche oder andere Huftiere. Etwa ein bis zwei Prozent ihres Nahrungsbedarfs decken sie jedoch mit Nutztieren, womit sie zum Problem für die Weidetierhaltung in der für Schutzmaßnahmen herausfordernden Landschaft im Südschwarzwald werden.
Mögliche Maßnahmen
Maßnahmen für den Schutz von Rindern können eine kompakte Herdenführung, die Integration wehrhafter Tiere sowie die Anpassung des Managements bei Abkalbung und Aufzucht sein. In Einzelfällen gilt auch der Einsatz von Herdenschutztieren als sinnvoll.
Ergebnisse aus der Forschung und Erfahrungen aus anderen Ländern sollen nun unter Schwarzwaldbedingungen erprobt werden. „Herdenschutzmaßnahmen bei Rindern werden an die regionale Herausforderungen angepasst“, kündigt Laura Huber-Eustachi von der FVA an. Ebenso in enger Abstimmung erfolgen nun die Festsetzungen zu zumutbaren Herdenschutzmaßnahmen bis Ende März.
Meist geklickt
Beilagen
Umfrage