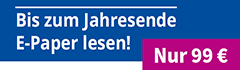Schönau (hf). Die Elektrizitätswerke Schönau (EWS) stellten am Schönauer Stromseminar im Juli ein neues innovatives Modellprojekt vor, um ein dezentrales bürgernahes Energiesystem auf Basis der erneuerbaren Energien zu realisieren. Klaus Mindrup, Mitglied des Deutschen Bundestags, ist der EWS seit längerem sehr verbunden. Da er am Stromseminar nicht persönlich teilnehmen konnte, stellte Alexander Sladek, Vorstandsmitglied der EWS, ihm bei seinem Besuch vor einigen Tagen das Projekt, seine Ziele und Absichten im Detail vor.
EWS: Modell zur intelligenten Bürgerenergie vorgestellt
Das Modellprojekt zur intelligenten Bürgerenergie ist so einfach wie beeindruckend, denn dahinter steht eine umfassende informations- und kommunikationstechnische Lösung. Diese könne das Ziel der EWS, Bürger aktiv bei der Umsetzung der Energiewende zu unterstützen, revolutionieren, so Sladek.
Klaus Mindrup zeigte sich nach der Präsentation beeindruckt und versprach, die Information an Politiker und Unternehmer weiterzugeben und sich für deren Verbreitung weiter einzusetzen. „Was ich von diesem Projekt hier gesehen habe, geht von seinem Ansatz und seiner bisherigen Realisierung über alles hinaus, was ich bisher gesehen habe. Dieses Modell verdient es, weiter kraftvoll unterstützt und propagiert zu werden“, erklärte Klaus Mindrup am Montag in Schönau.
Für das Modellprojekt arbeiten die EWS eng mit dem Triberger Energieversorger und Messstellenbetreiber EGT Energie GmbH und der Freiburger Software-Schmiede Oxygen Technologies GmbH, einer Ausgründung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE, zusammen. Das Jungunternehmen entwickelt Softwarelösungen, mit deren Hilfe ein optimiertes dezentrales Bürgerenergiesystem aufgebaut werden kann. Es werden Erzeuger- und Verbraucher in einer Gemeinschaft miteinander vernetzt. So können beispielsweise Wind-, Brennstoffzellen-, Wasser- und PV-Anlagen zu einem virtuellen Kraftwerk zusammengefasst werden.
Das Modellprojekt beginnt mit 29 Teilnehmern, darunter 22 klassische „Prosumer“, also Personen, die sowohl erzeugen als auch verbrauchen, drei Mieterstromobjekte, das Schönauer Schöpfungsfenster, eine Agrophotovoltaik-Anlage, sieben Blockheizkraftwerken, vier PV-Altanlagen, zwei Brennstoffzellen und drei Elektroautos.
In dem Zielsystem wird ein Peer-to-Peer-Ansatz verfolgt. In diesem Stadium agieren die Systeme eigenständig miteinander und die EWS fungiert nur noch als Betreiber der Plattform.
„Dieses Verfahren ist vom Austausch der benötigten Informationen her außerordentlich aufwendig“, erklärte Alexander Sladek.
Und um möglichst wenige Informationen austauschen zu müssen, setzten EWS und Oxygen nicht auf die bekannte Block-Chain-Technology, sondern arbeiten mit einer eigenen entwickelten Lösung. So entsteht bei minimalem Informationsfluss ein maximaler Nutzen für die Gemeinschaft.
„Mit diesem neuen Schönauer Modell schlagen wir ein ganz neues Kapitel der intelligenten dezentralen Bürgerenergie auf“, betonte Alexander Sladek zum Ende seiner Präsentation.
Meist geklickt
Beilagen
Umfrage