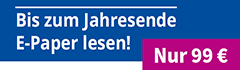Weil am Rhein-Märkt - Wer mit Hans-Dieter Geugelin über den Fischereilehrpfad zwischen Märkter Stauwehr und der früheren Kandermündung schlendert, erfährt viel über die aktuelle Gewässersituation und die Auswirkungen der Eingriffe der vergangenen 170 Jahre auf den Fischbestand des Rheins. Geugelin führte viele Jahre den Angelverein Weil am Rhein und Umgebung sowie bis zum Frühjahr die Interessengemeinschaft Altrhein.
Serie „850 Jahre Märkt“: Gewässersituation und Auswirkungen der Eingriffe auf den Bestand.
„Den Fisch aus dem Rhein ziehe ich jedem Zuchtfisch vor“, freut sich Geugelin auf seinen nächsten Fang. Dass der gebändigte Rhein nach all den Verbauungen, Begradigungen, katastrophalen Verunreinigungen seiner Gewässer und nach den Bemühungen um ökologische Gegenmaßnahmen wieder zum Fischparadies geworden wäre, bedeutet das freilich nicht. Auch nicht, dass die einst traditionsreiche Berufsfischerei in Märkt wieder eine Chance bekommen könnte. Der Arten- und Populationsschwund bleibt gewaltig, aber es gibt Lichtblicke.
Population stark gesunken
Um 45 bis 70 Prozent sei die Population der heimischen Arten am Oberrhein in den vergangenen 25 Jahren zurückgegangen, sagt Geugelin. Etwa, weil nur noch knapp 45 Kilometer des Flusses naturnah geblieben sind und weil die Insektenvielfalt als Teil der Nahrungsgrundlage der Fische extrem rückläufig ist. Neben Fischarten wurden auch die heimischen Kleinlebewesen wie Bachflohkrebse und Muscheln 1986 nach der Brandkatastrophe von Sandoz in Basel fast völlig ausgelöscht und die Gewässer danach zu rund 70 Prozent von nicht heimischen, invasiven Arten wiederbevölkert. Auch die früheren Altwasserarme als ruhige Laichplätze sind verschwunden, oder haben keine Verbindung mehr zum Hauptstrom. Den Wanderfischen wie Lachsen und Forellen sind zwischen Iffezheim und Basel zehn Staustufen – wenn auch teilweise mit Fischtreppen versehen – im Weg, in den Stillwasserzonen vor den Staustufen fehlt der Sauerstoff und den Kieslaichern fehlt das richtige Geschiebe für die Laichgrube.
Früher hieß es „Was fangen wir denn heute“, jetzt benötigt ein Angler vier bis fünf Fischgänge, bis er überhaupt Erfolg hat, weiß Geugelin. Fischfangstatistik ist Pflicht für jeden Angler, der seinen Fang aufzeichnen muss. Auf der 40 Kilometer langen Strecke zwischen Basel und Breisach gibt es zwar noch 24 Personen, die ein Patent für Berufsfischerei besitzen, doch zum Broterwerb dient er keinem mehr. Im ehemaligen Fischerdorf Märkt besitzt niemand mehr ein solches Patent. Nur gelegentlich werden die beiden Fischgalgen am Rheinufer bedient, meist von einem Hobbyfischer aus Rheinweiler. Traditionsgemäß betreute auch der frühere Märkter „Kronen“-Wirt einen der Galgen.
Grundel profitiert
Es gibt aber auch Profiteure der ökologischen Veränderungen: Invasive Arten, wie die Schwarzmeer-Grundel, haben sich inert vier Jahren zum Massenfisch entwickelt. Die Universität Basel hat ihre Population im Hafenbecken untersucht und 70 bis 80 Stück pro Quadratmeter gezählt.
Natur findet Lösung
Doch bevor der Mensch meint, wieder „regulierend“ eingreifen zu müssen, scheint die Natur eine Lösung zu finden: Heimische Raubfischarten wie Hecht, Zander sowie der vom Bodensee zugewanderte, bis zu 1,60 Metern große Wels, der sich seit dem Hitzesommer 2003 „pudelwohl bei uns fühlt“, seien auf den Grundel-Geschmack gekommen. Ihre Zahl habe deutlich zugenommen. „Das Räuber-Beute-System schlägt zugunsten der Räuber aus“, schmunzelt Geugelin.
Immer wieder bleibt er an einer der Informationstafeln des 1997 angelegten Fischereilehrpfads stehen und erläutert die teilweise von ihm selbst illustrierten detailreichen Informationen. 47 Fischarten gibt es am Oberrhein, darunter verschiedene Weißfischarten, Karpfen, Braxen, Barben und auch Nasen. Rückläufig sei die Population der Flussbarsche, der Rotauge so gut wie verschwunden. Die Äschen, die hohe Ansprüche an Wasserqualität und -temperatur stellen, gebe es kaum noch. Und dem Aal, „früher von Mai bis August ein lukrativer „Brotfisch“, der in Reusen gefangen wurde, geht es wie dem Lachs: Die Staustufen am Oberrhein und die Turbinen der Wasserkraftwerke sind tödliche Fallen. Zwar wurden immer mehr Staustufen, wie die bei Märkt, mit Fischtreppen versehen, aber es sind eben längst nicht alle entsprechend ausgerüstet.
Bis das Ziel, eine stabile Lachspopulation anzusiedeln, erreicht ist, dürfte trotz des einen oder anderen gesichteten Exemplars noch viel Wasser den Rhein hinunterfließen. Die IGAR setzt sich derweil für weitere ökologische Aufwertungen des Gewässers und seiner Zuflüsse ein, für den Anschluss des Hodbachs bei Istein und für die Märkter Weiher, den Resten der früheren Altrheinarme, deren Pegel sinkt.
Besonderes Augenmerk gilt dem kühlen und schattigen Grundwasserkanal. Geugelin zufolge ein ideales Aufzuchtgewässer – auch für Salmonide.
Geschichte
Stand die Fischerei ursprünglich am Oberrhein jedermann zu, wurden die Gewässer im Mittelalter den Fischern auf Zeit verpachtet, wofür sie einen Zins zahlen mussten. Ab dem 18. Jahrhundert verpachteten die Gemeinden ihre Fischgewässer zugunsten der Gemeindekasse, meist an in Zünften organisierte Fischer.
Wegen seiner Armut hatte Märkt schon im 16. Jahrhundert das Hoheitsrecht für die Fisch- und Vogelwaid im Rhein und in der Kander. Vom Fischzins waren die Märkter weitgehend befreit, lediglich für die Lachswaid im Rhein und den Altwassern sowie für das Krebsen in der Kander mussten sie jährlich zehn Schilling an die Röttler Herrschaft entrichten. Zudem mussten sie der Gemeinde Haltingen 50 bis 60 Pfund Lachs liefern. Das galt als Pacht für das von den Hiltelinger Fischern im 17. Jahrhundert aufgegebene Revier, als ihr Dorf am Rhein in Kriegen zerstört wurde und sie nach Haltingen umsiedelten. Die Situation heute Seit 2007 vertritt die Interessengemeinschaft Altrhein (IGAR) elf Fischereivereine entlang der Pachtstrecke von Weil am Rhein bis Breisach – mit Ausnahme der Strecke in Neuenburg. Auf den rund 33 Pachtkilometern der IGAR gilt für die Mitglieder nun eine Angelkarte. Die IGAR organisiert – quasi als Nachfolgerin der mittelalterlichen Fischerzünfte – nicht nur die Pacht der staatlichen Rheinlose für alle Mitgliedsvereine, sondern will sich auch für die ökologische Aufwertung des Gewässers, etwa dessen Durchgängigkeit für Lachsfische einsetzenen.
„Wir haben im Verbund eine bessere Durchsetzungskraft gegenüber den Behörden“, betont Hans-Dieter Geugelin, der den IGAR-Vorsitz im Frühjahr an Christof Klemt abgegeben hat. Im Blick hat die IGAR dabei nicht nur Verbesserungsvorschläge für den naturnahen Anschluss der Rhein-Nebenflüsse, sondern auch die Regulierung der Kormoranbestände.
Meist geklickt
Beilagen
Umfrage