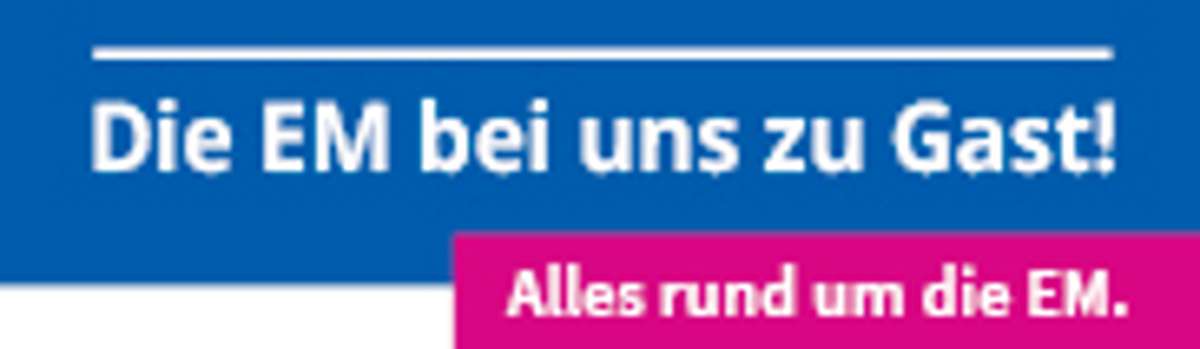Kreis Lörrach. Wo stehen deutsche Unternehmen aktuell und wo ist angesichts der demografischen Entwicklung der größte Nachholbedarf erkennbar? Prof. Dr. Uwe Schirmer, Professor für Personalmanagement und Mitarbeiterführung an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Lörrach, liefert mit seiner Studie „Demografie Exzellenz: Herausforderungen im Personalmanagement 2015“ eine Standortbestimmung.
Studie: DHBW in Lörrach analysiert Herausforderungen der demografischen Entwicklung für Unternehmen
Der Experte hat im Gespräch mit Regio-Redakteur Marco Fraune neben der bundesweiten Betrachtung auch die Besonderheiten im Dreiländereck im Blick.
Der Titel Ihrer Studie bietet eine Steilvorlage: Vor welchen Herausforderungen stehen Personalverantwortliche aktuell angesichts des demografischen Wandels?
Der Arbeitsmarkt weist seit dem Jahr 2005 zwei sich gegenläufig entwickelnde Kurven auf: Es gibt die ansteigende Kurve der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse und auf der anderen Seite die seit 2005 stetig leicht fallende Zahl der Arbeitssuchenden. Hinzu kommen die beiden demografischen Kerneffekte. Der erste ist die älter werdende Gesellschaft und Erwerbsbevölkerung, das heißt: Dadurch, dass wir absolut immer weniger Geburten haben, gleichzeitig aber die Lebenserwartung steigt, werden die Bevölkerung und die Belegschaften älter. Ab dem Jahr 2020 kommt dann der zweite demografische Aspekt so richtig in den Unternehmen zum Tragen, wenn die Babyboomer innerhalb von fünf bis zehn Jahren geschlossen in Rente gehen, also die aktuell größte Arbeitnehmergruppe. Dies ist eine große demografische Herausforderung.
Sie haben schon bei der Veröffentlichung der ersten Studie im Jahr 2009 prognostiziert, dass spätestens ab dem Jahr 2015 große Probleme auf die Unternehmen in Baden-Württemberg zukommen. Nun verschiebt sich das Problem also in die Zukunft?
Es ist im Moment tatsächlich nicht so dramatisch, wie wir es damals gesehen haben. Einige Sondereffekte konnte man damals in der Form noch nicht erkennen. Seit vier Jahren haben wir einen derart hohen Zuzug, dass nicht nur die Wegzüge, sondern im Augenblick sogar das Geburtendefizit ausgeglichen werden. Dass Deutschland jedes Jahr etwas wächst, ist eine überraschende Wendung. Der starke Zuzug schiebt den demografischen Aspekt etwas hinaus.
Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben?
Es wird auf Dauer nicht so bleiben. Ansonsten würden wir noch eine ganz andere demografische Herausforderung bekommen, die als Heterogenisierung bezeichnet wird. Wir sind in Deutschland mit unserer Kultur und Tradition im Moment noch nicht ausreichend darauf eingestellt, auf Dauer eine derart große Zahl von Zuwanderern beruflich, sozial und gesellschaftlich zu integrieren. Das gilt auch und gerade für die Unternehmen.
Besonders das Dreiländereck profitiert aktuell aber vom Zuzug.
Das ist der Fall. Und hier im Großraum Lörrach sind die demografischen Herausforderungen anders ausgeprägt als beispielsweise schon im Hotzenwald. Dort gibt es nicht die Attraktivität von Zuzug, die wir hier haben. In vielen Landkreisen in Baden-Württemberg sieht es auch nicht ganz so rosig aus wie in Lörrach.
Vor drei Jahren, also bei der Neuauflage Ihrer ersten Studie, haben Sie noch moniert, dass sich Wirtschaft und Industrie zu einseitig auf Maßnahmen zum Gesundheitsmanagement konzentriert haben. Hat sich dort ein Wandel zum Positiven vollzogen?
Nein. In Baden-Württemberg hat es sich insgesamt sogar leicht verschlechtert. Selbst beim Gesundheitsmanagement gab es eine rückläufige Tendenz.
Haben die Personalverantwortlichen Ihre Studie nicht gelesen?
Einschränkend zu diesem Ergebnis muss man natürlich sagen, dass nicht die gleichen Unternehmen befragt werden. Dieses Mal haben sich 361 Unternehmen aus Baden-Württemberg beteiligt. Es könnte theoretisch sein, dass keiner der Betriebe 2012 befragt wurde. Es ist keine Panel-Befragung, sondern eine offene.
Was hat sich denn als große Veränderung ergeben?
Es ist das erste Mal, dass wir bundesweit geforscht haben. Dabei beteiligten sich 1499 Unternehmen. Bei diesen hat sich ein klarer Trend abgezeichnet, dass Wissensmanagement und Personalentwicklung bundesweit im Jahr 2015 die intensivsten und ausgearbeitetsten Handlungsfelder sind, mit denen sich die Unternehmen diesem Handlungsfeld nähern. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass sie jetzt einsetzend verstärkt mit Wissensabflüssen konfrontiert sind, wenn die älteren Beschäftigten in Rente gehen.
Greift die Gleichung „demografischer Wandel = Fachkräftemangel“ hier zu kurz?
Es gibt noch andere Effekte. Denken Sie an die Belegschaftsstruktur, die in den nächsten Jahren im Durchschnitt noch einmal altern wird, womit sich das Kompetenzportfolio verändern wird. Körperliche Fähigkeiten wie Sehen und Hören lassen mit zunehmendem Alter etwas nach. Dagegen steigen soziale Kompetenzen, Erfahrungswissen oder auch die Fähigkeit, in kritischen Situationen den Überblick zu bewahren. Zudem werden wir uns beim Thema Gesundheit und Beschäftigungsfähigkeit verstärkt Gedanken machen müssen, weil die Politik das Rentenalter bereits auf 67 Jahre in 2029 angehoben hat.
Sie geben mit der Studie Handlungsempfehlungen für Unternehmen. Eigentlich ist Forschung das Betätigungsfeld der Universitäten. Wie kommt es, dass die DHBW Lörrach und Sie als Verfasser der Studie schon seit einigen Jahren in diesem Bereich aktiv sind?
Wir haben in unserem Fachgebiet im Jahr 2006 begonnen, im Rahmen eines damals noch „Age diversity“ genannten Projektes uns dem Thema zu widmen. Zusammen mit freiwillig Engagierten starteten wir 2009 mit externen Partnern, den sogenannten Demografie-Exzellenz-Award zu gründen. Mit diesem Preis haben wir seitdem Jahr für Jahr Unternehmen ausgezeichnet, die Leuchtturmprojekte im demografieorientierten Personalmanagement oder bei der Dienstleistungs- und Produktpolitik aktiv sind. Das ist auch aufgrund eines persönlichen Interesses meinerseits dann gewachsen. Mittlerweile haben wir aus dieser Initiative auch einen eigenen Verein, den „Demografie Exzellenz“ gegründet. So ist das ganze entstanden. Hinzu kommt natürlich noch, dass wir mit der Umwandlung der Berufsakademie in die Duale Hochschule Baden-Württemberg auch einen Forschungsauftrag im Landeshochschulgesetz erhalten haben, eine kooperative Forschung zu betreiben. Das tun wir hier. Wir bleiben nicht mit diesen Ergebnissen stehen, sondern werden noch verstärkt Handlungsanweisungen geben. Ein Buch, das Ende dieses Jahres erscheinen soll, ist in Arbeit.
Die Studien sind anwendungsorientiert. Was stimmt Sie optimistisch, dass sechs Jahre nach der ersten Studie noch etwas mehr getan wird als zu Beginn in diesem Bereich?
Wer sagt, dass ich positiv gestimmt bin?
Sind Sie nicht?
Ich gehe als Wissenschaftler völlig wertneutral an das Thema. Ich will analysieren: Tut sich etwas? Natürlich habe ich die Hoffnung, aber mir geht es vorrangig darum zu sehen, wie der Status quo ist und wo Handlungsbedarfe liegen. Dabei zeigt sich: Es ist es erschreckend, dass sich noch zu wenig verändert, weil viele Unternehmen die strategische Dimension des Themas noch nicht erkannt haben.
Warum ist das der Fall?
Es ist wie beim Klimawandel. Wir wissen: Es tut sich was im Hintergrund, wir merken aber noch nicht heute oder übermorgen den Unterschied. Wir wissen eigentlich alle: Es steht der demografische Wandel an, doch im Moment kommt man mit einer Strategie des „Durchwurstelns“ in einigen Fällen gerade noch weiter. Wenn man sich das Szenario betrachtet, dann werden aber die Unternehmen gewinnen, die sich künftig vorausschauend und attraktiv am Markt mit entsprechenden Maßnahmen positionieren.
Was aber vor allem die größeren können?
Können tun es auch die Kleineren. Bei uns im Landkreis gab es das regionale Projekt „Demografie aktiv gestalten“ unterstützt durch den Europäischen Sozialfonds und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, bei dem speziell auch Instrumente für ganz kleine Unternehmen ausgearbeitet und auf der Internetseite der Wirtschaftsregion Südwest veröffentlicht wurden. Nur die Betriebe nutzen es nicht. Das ist natürlich in gewisser Weise nachvollziehbar, da sie auch eine kleinere Personaldecke haben und daher stark operativ getrieben sind. Wir empfehlen daher, sich mit zwei oder drei befreundeten Unternehmen in der Nähe zusammenzutun und Kraft zu bündeln.
Sie haben den bundesweiten Vergleich: Hier im Südwesten klagen wir doch eigentlich auf einem hohen Niveau, oder?
Ich glaube, dass es uns im Dreiländereck noch vergleichsweise gut geht. Hier gibt es die besondere Herausforderung mit dem Arbeitsmarkt in der Schweiz. Das weiß jeder. Wir haben ein großes Lohngefälle. Das spürt jeder Unternehmer, der versucht, Mitarbeiter zu binden und zu finden. Grundsätzlich, auch was den Zuzug betrifft, stehen wir aber relativ gut da. Sehr kleinräumig kann es hingegen schon große Unterschiede geben, wie sich beim Vergleich Lörrach und Hotzenwald zeigt.
Meist geklickt
Beilagen
Umfrage