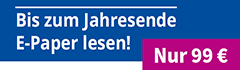Basel - Die Schweizer stimmen am 27. September über die sogenannte Kündigungsinitiative der SVP ab, welche den bilateralen Weg mit der Europäischen Union über Bord werfen will. Auf dem Spiel steht nicht nur die grenzüberschreitende Personenfreizügigkeit. Auch der Wirtschaftsstandort Schweiz ist gefährdet, wie ein überparteiliches Komitee mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft warnt.
Kündigungsinitiative der SVP. Abstimmung Ende September. Gegenwind von überparteilichem Komitee
„Als führender Forschungs- und Exportstandort sind wir auf eine gute Beziehung zu unseren Nachbarn angewiesen“, erläuterte Martin Dätwyler, Direktor der Handelskammer beider Basel, gestern im Rahmen eines Mediengesprächs des Komitees beider Basel „Nein zur radikalen Kündigungsinitiative“.
„Die Initiative fordert die Kündigung des Personenfreizügigkeitsabkommens. Aufgrund der Guillotine-Klausel bedeutet dies das Ende sämtlicher Bilateralen Verträge I, darunter wichtige Abkommen im Bereich der Forschung und der technischen Handelshemmnisse.“ Die Initiatoren böten keine Alternative, wie die Schweiz den Zugang zum EU-Markt sichern könnte. Und der ist für die Schweiz und die Region Basel von großer Bedeutung, wie im Rahmen des Pressegesprächs deutlich wurde: 25 Prozent aller Schweizer Exporte in die EU stammen aus beiden Basel, jeder zweite Arbeitsplatz ist exportabhängig, und 76 Prozent aller Direktinvestitionen in der Alpenrepublik kommen aus der EU. Zudem ist sie noch vor China und den USA der wichtigste Handelspartner.
Zuwanderung begrenzen
Im Kern will die SVP mit ihrer Initiative die Zuwanderung in die Schweiz begrenzen, was sie bereits mit der vom Stimmvolk angenommenen Masseneinwanderungsinitiative (MEI) angestrebt hat. Die neue Initiative ist laut SVP eine Folge der mangelhaften Umsetzung der MEI. Denn während die SVP Nägel mit Köpfen machen wollte, setzt die Politik auf den seit 1. Juli 2018 eingeführten Inländervorrang. Damit soll das inländische Arbeitskräftepotenzial besser genutzt werden, ohne an der wichtigen Personenfreizügigkeit zu kratzen.
Letztlich einigte man sich auf eine Meldepflicht von offenen Stellen und arbeitslosen Personen. Besagte Meldepflicht gilt derweil nur in Branchen, in denen die Arbeitslosigkeit hoch ist. Und: Arbeitgeber sind generell nicht dazu verpflichtet, Inländer einzustellen. Laut Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) funktioniere der Inländervorrang gut, allerdings habe dieser keinen Einfluss auf die Zuwanderung.
Fachkräftemangel
Die Schweiz sei vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels auf Zuwanderung beziehungsweise Grenzgänger angewiesen, betonte Elisabeth Schneider-Schneiter, Präsidentin der Handelskammer beider Basel. Der Fachkräftemangel werde sich weiter zuspitzen, stellte LDP Nationalrat Christoph Eymann klar: „Ökonomen rechnen damit, dass in den nächsten zehn Jahren ein zusätzlicher Bedarf von 300 000 Arbeitskräften entsteht. Deshalb müssen Unternehmen weiterhin flexibel Angestellte auch in Europa rekrutieren können – die Personenfreizügigkeit erlaubt ihnen das.“
Flankierende Maßnahmen
Die flankierenden Maßnahmen, die Verstöße gegen das Schweizer Lohnschutzniveau und Missbräuche ahnden, würden dabei für faire Wettbewerbsbedingungen für das einheimische Gewerbe sorgen, ergänzte SP-Nationalrat Eric Nussbaumer. Er machte darauf aufmerksam, dass sich das Lohnniveau seit Einführung der Personenfreizügigkeit im Jahr 2002 positiv entwickelt habe. Auch könne nicht die Rede von einer Verdrängung Schweizer Arbeitnehmer sein, richtete er sich an die Befürworter der Kündigungsinitiative. „Diese schadet dem Wirtschaftsstandort und den Arbeitnehmern in der Region.“
Weniger Bürokratie
Aus Sicht der Pharmabranche machte Matthias Leuenberger, Länderpräsident Novartis Schweiz, deutlich, dass die Wirtschaft in der Region enorm erfolgreich sei. „Für unseren Wohlstand sind die Vernetzung mit der EU und die bilateralen Verträge eine wichtige Voraussetzung.“
Fatale Folgen
Eine Annahme der SVP-Initiative hätte fatale Folgen, insbesondere für mittlere und kleine Unternehmen, verwies er unter anderem auf das Abkommen, technische Handelshemmnisse abzubauen. Verträge mit der EU ermöglichten der Schweiz, ohne viel Bürokratie in die EU zu exportieren. Das würde sich ändern, sollte die SVP am 27. September erfolgreich sein. Indes würden die Bilateralen dafür sorgen, dass sich die Schweizer Wirtschaft weiterhin optimal entwickeln könne und für Inländer zusätzliche Arbeitsplätze entstünden.
„Dank der Personenfreizügigkeit stehen der Forschung, dem Gesundheitswesen und den Unternehmen jederzeit genügend Fachkräfte zur Verfügung“, wie Anton Lauber, Regierungsrat Baselland und Präsident der Nordwestschweizer Regierungskonferenz, ergänzte. Negative Folgen fürchtet auch Andrea Schenker-Wicki, Rektorin der Uni Basel: „Mit einer Annahme der Initiative verliert die Schweiz das Forschungsabkommen mit der EU und damit den Zugang zu milliardenschweren Programmen.“
Derweil ist für Elisabeth Ackermann, Regierungspräsidentin des Stadtkantons, klar: „Die Bilateralen bedeuten Sicherheit, Wohlstand und ein Plus an persönlicher Freiheit für uns alle. Mit der initiative will man uns die Freiheit wegnehmen.“ Diese Freiheit gelte es aber zu bewahren, warb sie mit ihren Mitstreitern für eine Ablehnung an der Wahlurne.
Meist geklickt
Beilagen
Umfrage