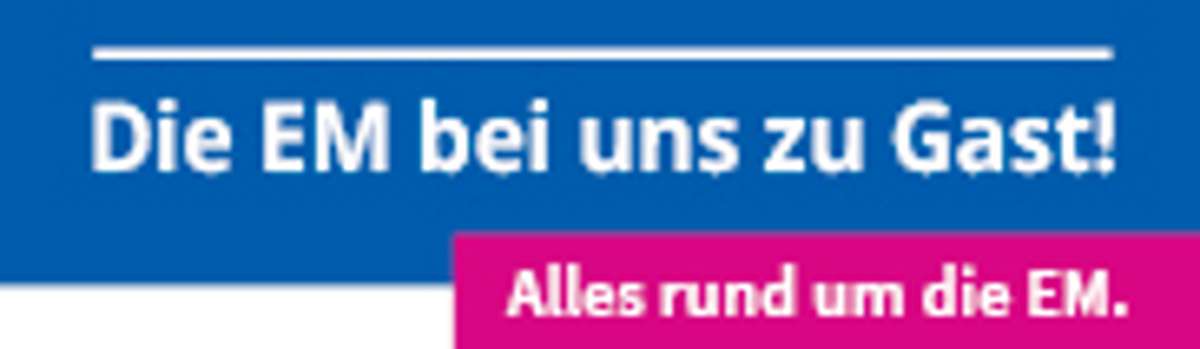Der eine hat die Grüne Welle, der andere sieht Rot: So ist das nun einmal im Straßenverkehr, schließlich soll der Verkehr ja möglichst flott und reibungslos fließen. Damit dies aber garantiert ist, braucht es ein ausgeklügeltes System von Ampelanlagen.
Verkehr: Aufwendige Technik steuert Basler Verkehrsfluss / Blick hinter die Kulissen
Basel (lu). In Basel gingen 1950 bei der Schifflände und auf dem Claraplatz die beiden ersten Basler Ampeln in Betrieb. Genau 128 dieser Anlagen besitzt die Stadt Basel heute. Sie alle sorgen dafür, dass Fußgänger und Radfahrer sowie die Autofahrer und auch der öffentliche Verkehr gut aneinander vorbeikommen.
Was früher ein Beamter mit Handzeichen erledigen musste, funktioniert in Basel längst vollautomatisch. Beim Pressetermin erklärte Clemens Huber, Leiter Verkehrssteuerung vom Amt für Mobilität, wie es geht. Dazu hat er sich mit dem Knotenpunkt Schützenhaus eine der komplexesten Lichtsignalanlagen von Basel ausgesucht. Nicht weniger als 73 Ampeln mit 159 Lampen gehören an dieser Kreuzung dazu.
Ganz klar: Diese Kreuzung – und auch alle anderen – steuert der Computer. Angeschlossen an den zentralen Verkehrsrechner der Stadt, regelt beim Schützenhaus ein aufgestelltes Steuergerät die Abläufe. Dieses ist das „Gehirn“ der gesamten Kreuzung und verarbeitet die Signale von insgesamt 144 sogenannten Informationspunkten, wie beispielsweise 54 Detektoren sowie die Meldungen der Trams und Busse (via Funk),die durchfahren wollen. „Ohne die Lichtsignalanlagen würden die diversen Verkehre nicht aneinander vorbeikommen und kämen zum Erliegen“, erklärt Huber.
600 000 bis 700 000 Franken kostet die Steuerung der „Schützenhaus“-Kreuzung, dies aber nur, weil seit einigen Jahren koordiniert gebaut und installiert wird.
Allein der Bau kann sechs Monate dauern
„Früher musste die Stadt dafür mal mehr als eine Million Franken aufbringen“, so der Leiter der Verkehrssteuerung. Und: Schon die Inbetriebnahme einer solchen Anlage braucht seine Zeit. „Allein der Bau kann sechs Monate dauern“, weiß Huber.
Vieles funktioniert über Sensoren, die erkennen, welche Ampel ein grünes Signal benötigt. „Mittels elektromagnetischen Schlaufen im Straßenbelag erkennt das System beispielsweise Autos und Velos“, verrät der Experte und erklärt weiter: „Es bringt somit nichts, wenn man auf den Boden stampft oder eine Lichthupe gibt.“ Auch bei den Fußgängern reiche es, wenn man den Anmelde-Knopf einmal drückt. Mehrmaliges Drücken bringt rein gar nichts.
Sollten Störungen bei einer Anlage auftreten, da beispielsweise ein Sensor aussteigt, schaltet die betroffene Ampel je nach Störung sicherheitshalber aus oder blinkt kontinuierlich orange. Der Zentralrechner meldet die Störung unmittelbar, sodass man die Störung möglichst schnell beheben kann.
Für die Zukunft hat das Amt für Mobilität einige Ideen. „Die Interaktion zwischen Fahrzeug und Ampel wird ausgebaut“, sagt Huber. So werden künftig zum Beispiel selbstfahrende Autos Informationen an die Lichtsignalanlagen senden, was zu einem ständigen Datenaustausch führt. Zudem dürften vermehrt Kameras zum Einsatz kommen, die unter anderem das Fußgängeraufkommen ermitteln und ihre Daten an die Anlage senden.
Meist geklickt
Beilagen
Umfrage