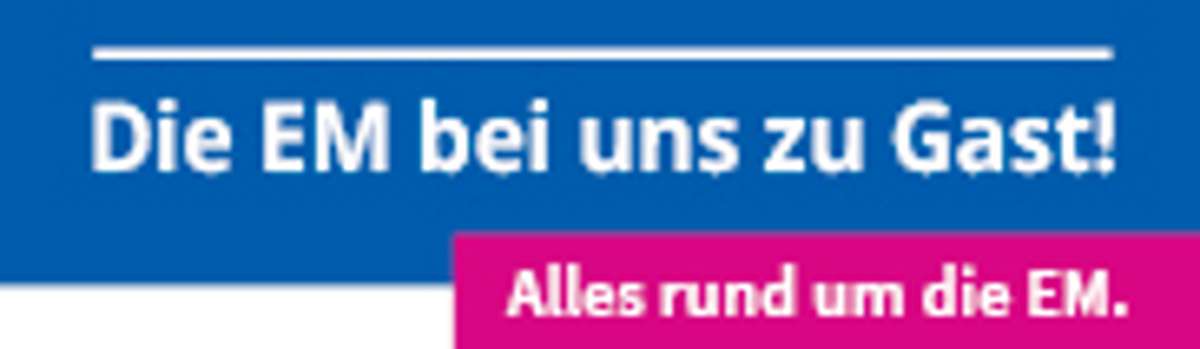Nach langen Wochen der Grenzschließung sehnt man sich langsam wieder nach unseren Schweizer Nachbarn. Gespenstisch ist sie fast, die Atmosphäre im zeitweise menschenleeren Aldi am Grenzacher Hörnle. Es wird uns bewusst, wie sehr unsere Wirtschaft von der Schweizer Kundschaft abhängig ist. Und das war immer so.
Geschichte: Ohne die nahe Eidgenossenschaft und ihre Bewohner ging in Grenzach auch früher nur wenig
Basel ist das Zentrum unserer Region und strahlt auf seine Umgebung aus, so wie es alle großen Städte tun. Und das Umland, in früheren Zeiten vor allem landwirtschaftlich geprägt, versorgt die Stadt mit Lebensmitteln.
Grenzach-Wyhlen. Auf der Suche nach historischen Verhältnissen in Grenzach lohnt es sich sehr, die im Jahr 1957 erschienene Urkundensammlung von Pfarrer Ebner zu durchforsten. Da erfahren wir zum Beispiel vom Waldhorn-Wirt Nikolaus Franz. Der stammte aus Basel, hatte das Grenzacher Schlössle gekauft und 1745 das Gasthaus Waldhorn gebaut – natürlich in der Hoffnung auf Basler Gäste.
„Wegen der Tänze kämen keine Markgräfler“
Franz ist angewiesen auf die Besucher aus Basel, für die er eine Tanzerlaubnis, einen sogenannten „Tanzzettel“, braucht. In seinen Bittbriefen an die Obrigkeit schreibt er explizit, dass er das Gasthaus Waldhorn für die Basler gebaut habe, denn „wegen der Tänze kämen keine Markgräfler“, die seien zu entlegen. Der Gastronom verspricht, sich an die Regeln zu halten, denn an Sonntagen und hohen Festtagen sind Tanz und Lustbarkeit nicht erlaubt.
Schlussendlich hat man in Karlsruhe ein Einsehen und schreibt im April 1747: „Der Waldhornwirt Nikolaus Franz hat seine Nahrung hauptsächlich und fast gänzlich von der nahe bei seiner Wirtschaft gelegenen Stadt Basel, deren Einwohner öfters im Jahr, insbesondere an Feiertagen, dorthin spazieren fahren oder gehen und andere erlaubte Ergötzlichkeiten suchen. Wir sind nicht dagegen, wenn dem Waldhornwirt zu besserer Beförderung seiner Nahrung erlaubt wird, an Feiertagen nach dem Gottesdienst ehrbare Saitenspiele in seiner Wirtschaft gebrauchen zu dürfen. Jedoch dürfe solches mit der ausdrücklichen Ausbedingung geschehen, dass Franz an hohen Festtagen, auch an Sonntagen, ebenso am großen Buß- und Bettag, wie nicht weniger an den monatspflichtigen Gebetstagen äußerst besorgt sei, dass anlässlich dieser Tänze nichts der christlichen Zucht und Ehrbarkeit Zuwiderlaufendes vorgehen möge…“
„Beständigen Verdruß“ mit Katholiken
Als der aus Eptingen im Kanton Baselland stammende Ziegler Jakob Müller sich im protestantisch geprägten Grenzach selbständig machen wollte, gab es Komplikationen. Einerseits aus Konkurrenzgründen, andererseits aber auch deshalb, weil man der Meinung war, er sei Katholik. Man habe nämlich „mit den hin und her in dem Land befindlichen Katholiken beständigen Verdruß“, so die Argumentation.
Als sich aber herausstellte, dass er der reformierten Religion zugetan war, wurde die Sache etwas einfacher. Müller musste aber versprechen, dass er „alle ehelich erzeugten Kinder und die etwa noch erzeugt werden“ evangelisch-lutherisch erziehen werde.
Schon früher zielte man auf Basler Gäste ab
Am 8. Januar 1767 schickten die Grenzacher einen Brief an den Markgrafen mit dem Wunsch, in Grenzach zwei Vieh- und Krämermärkte abhalten zu dürfen, die dem Ort „zu besserer Nahrung“ verhelfen könnten. Man argumentiert in dieser Bittschrift damit, dass Grenzach an einer wichtigen Durchgangsstraße von Basel nach Schaffhausen liege und außerdem die Nähe zu Basel große Hoffnung auf Erfolg wecke.
Das gelte nicht nur für den gewünschten Markt am 24. Juni, der auf eine alte Tradition zurückgehe, sondern vor allem auch für den Markt am 22. Oktober, da zu dieser Zeit in Basel eine Messe stattfinde. „Da nun wohl um eines solchen kleinen Ortes willen aus entfernten Landen keine große Menge von Kaufleuten und Händlern zu erwarten ist, so kommen doch der Basler Messe wegen von allen Seiten her Käufer und Verkäufer in großer Anzahl“, so lesen wir.
Johannimarkt fällt wegen Coronavorgaben aus
Auch Landvogt Wallbrunn in Lörrach unterstützte die Wünsche der Grenzacher, was zur Folge hatte, dass bereits am 31. Januar die Genehmigung aus Karlsruhe zugestellt wurde. Wie schnell haben da die Beamten gearbeitet – drei Wochen Bearbeitungszeit für diesen Vorgang!
Mit „Markt“ wird es heuer in Grenzach jedoch nichts werden: Einerseits fällt der Johannimarkt in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aus, andererseits ist der frühere Herbstmarkt schon lange „eingeschlafen“.
Situation am „Hörnli-Zoll“ besteht bis heute fort
Betrachten wir zum Abschluss die obige Abbildung aus dem Jahr 1837 etwas genauer. Sie stammt aus der Zeitschrift „Der Wanderer in der Schweiz“. Wir sehen vergnügte Ausflügler in sonntäglicher Tracht, eine zweispännige Kutsche, die wohl nicht Halt macht im „Gasthaus zum Horn“, das gerade einige durstige Wanderer betreten. Im Hintergrund erhebt sich fast majestätisch der Grenzacher Hornfelsen, an dessen Flanke, wie auch an der Rheinhalde, Rebberge zu erkennen sind. Erfreulich, dass sich dieses Ensemble und das Gasthaus bis zum heutigen Tag erhalten haben.
„Schengen“ war früher gang und gäbe
Aber wo ist die Grenze, wo ein Zollhaus, wo ein Zöllner? Lediglich ein hoher Pfahl mit einer kleinen Plakette scheint die Grenze zu markieren. Und tatsächlich kannte man zu dieser Zeit, ja bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, keine Personenkontrollen. „Schengen“ gab es also schon einmal.
Auf der rechten Seite der Darstellung schwenkt ein einfach gekleideter Mann seinen Hut und begrüßt augenscheinlich die Freunde aus Basel. Hoffentlich können auch wir bald wieder den Hut schwenken.
Meist geklickt
Beilagen
Umfrage