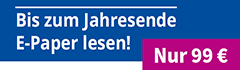Die Stühle im „Jardin-Saal“ des Kurhauses sind zu drei Viertel besetzt. Auf dem Podium wartet Nicola Steiner, sie ist die neue Chefin des Literaturhauses in Zürich. Das Publikum ist im Durchschnitt 60 plus und gesetzt. Blickt man aus den Fenstern, hat man eine wunderbare Sicht auf die scheinbar friedliche Welt des Kurparks.
Irina Kilimnik liest bei den Literaturtagen, die das Motto Familienbande haben, aus ihrem autofiktionalen Roman „Sommer in Odessa“. Was können wir mitnehmen?
Kilimnik ist 1978 in Odessa geboren, 1993 zog sie nach Deutschland. Sie hat zunächst Medizin studiert, dann Verlagswirtschaften. Ihren Familienroman „Sommer in Odessa“ schrieb sie in Berlin, die Handlung spielt in der Hafenstadt am Schwarzen Meer. Zu den Protagonisten zählen drei Töchter, vier Enkeltöchter und ein despotischer Großvater. Das Schicksal Olgas, der jüngste Enkeltochter, ist in Teilen die Geschichte der Autorin.
Olga will ausbrechen
Da Olga kein Junge ist, wird sie in der Familie nur respektiert, wenn sie Medizin studiert. 1994 habe sie in Deutschland angefangen, Tagebuch zu schreiben, erzählt die Autorin. Da habe sie sich selbst schon gefragt: „Soll ich wirklich Medizin studieren?“ Olga sei doppelt belastet, stellt die Moderatorin Nicola Steiner fest. Als letztgeborenes Mädchen spüre sie den Unmut des Großvaters. Die Familie entscheidet, sie als zukünftige Medizinerin zu „nobilitieren“, um so ihre Position zu erhöhen. Auch in Mascha, seit Kindheitstagen beste Freundin von Olga, stecke ein bisschen Biografisches, sagt Kilimnik. Mascha will in den Westen gehen und sucht als Au-pair eine Gastfamilie.
Der Despot in der Familie
Der Großvater verkörpere die alte, untergegangene Welt, fügt Kilimnik hinzu. Er ist das Familienoberhaupt, herrschsüchtig und Altkommunist. Aus seiner Sicht seien die Töchter an allen Familienproblemen schuld, vor allem, weil sie keine Söhne gebären. So geht er fremd, zeugt mit einer anderen einen Sohn.
Der Großvater sei eine typische osteuropäische Figur, erläutert die Autorin. Bis heute gebe die ältere Generation den Ton an. Die Familienbande seien in Osteuropa komplexer, es gäbe Clanstrukturen, man überlade die nachkommende Generation mit „Schuldgefühlen“, man müsse den Familienauftrag erfüllen, gehorchen. Nur langsam ändere sich etwas, die jüngere Generation setze sich durch.
Eine Multikulti-Stadt
Viele Literaten haben der schönen Stadt Odessa ein Denkmal gesetzt, sagt Steiner. Von wem habe sich Kilimnik literarisch inspirieren lassen, will sie wissen. Sie sei gebürtige Odessiterin, gibt diese selbstbewusst zur Antwort. Odessa sei eine Multikulti-Stadt, dort lebten Russen, Juden, Ukrainer und Griechen lange Zeit friedlich miteinander. Da Odessa Teil des Sowjetischen Reiches gewesen ist, sprachen bis 2005 über 90 Prozent der Einwohner russisch. Mittlerweile nehme das Ukrainisch zu, man werde selbstbewusster. Ukrainisch sei im Übrigen auch nicht ihre Muttersprache, meint Kilimnik, in ihrer Familie wurde Russisch gesprochen. Das Buch habe sie auf Deutsch verfasst, die Distanz der Sprache helfe ihr, klarer zu gestalten.
Risse gehen durch Familien
Das Buch entstand im Schatten des Krimkriegs. 2014 wurde die Halbinsel von den Russen besetzt. Immer wieder sei der Euromaidan, die proeuropäische Protestbewegung, ein Thema im Buch, erläutert Kilimnik. Das war ein deutliches Zeichen, dass die Ukraine gen Westen aufbreche. Da vibrierte es schon auf vielen Ebenen, Risse gingen durch die Familien. Schon deshalb habe sie den Krieg nicht mit ins Buch aufgenommen.
Ein unfassbarer Krieg
Dass Russland die Ukraine angreift, konnte Kilimnik zuerst nicht glauben. Tagelang habe sie am Telefon gehangen und mit Freunden und Verwandten gesprochen. Sie selbst sei in den Medien versunken, habe sich auf deutschen, ukrainischen und russischen Webseiten informiert. Zunächst sei Odessa vom Krieg verschont geblieben, sagt die Moderatorin. Wie ist die Situation jetzt, fragt sie. „Das Leben muss weitergehen“, stellt Kilimnik fest. Die besondere Euphorie der unerwartet hohen Wehrhaftigkeit gebe es nicht mehr, eine gewisse Nüchternheit herrsche nun. „Was mich positiv überrascht, die Leute gehen wieder in die Oper und ins Theater.“
Meist geklickt
Beilagen
Umfrage