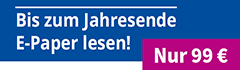Gudrun Schubert, Vorsitzende der Schubert-Durand-Stiftung, wird heute Abend bei der Benefizgala der Lörracher Bürgerstiftung die Bürgermedaille entgegen nehmen. Die Bürgerstiftung würdigt damit das Engagement der promovierten Islamwissenschaftlerin für die Integration von Mädchen und Frauen aus dem muslimischen Kulturkreis und den Dialog von Kulturen und Religionen. Bernhard Konrad sprach mit Gudrun Schubert über die Situation muslimischer Mädchen in Lörrach, ermutigende und ernüchternde Facetten der Stiftungsarbeit und aktuelle Fragen der Integration.
Frau Schubert, weshalb engagieren Sie sich auf diesen Themenfeldern mit einer Stiftung?
Unsere Arbeit setzt bei den Themen Bildung und Ausbildung an. Die Schubert-Durand-Stiftung wurde für Mädchen und Frauen aus diesem Kulturkreis gegründet, weil sie oftmals geringe Bildungschancen haben. Mädchen mit muslimischem Hintergrund kommen innerhalb der Familie meist an zweiter Stelle. Mit Blick auf die spätere Heirat wird die Notwendigkeit einer Ausbildung mitunter gar nicht erst gesehen. Letztlich möchten wir den Mädchen und jungen Frauen helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Integration: Interview mit Gudrun Schubert / Islamwissenschaftlerin erhält Bürgermedaille der Bürgerstiftung
Auf welche Weise fördert die Stiftung?
Wir fördern sowohl operativ als auch Einzelfälle. Melahat Aygüner-Ulec arbeitet intensiv mit türkischen Frauen in Schulen und Kindergärten, etwa in dem Projekt „Starke Eltern, starke Kinder“, sie organisiert – gelegentlich gemeinsam mit der Caritas – Frauenfrühstücke, liest in Kindergärten und der Bibliothek vor, sie studiert Stücke für das internationale Kinderfest ein und sie hilft Frauen bei Behördenanträgen und anderen Fragen. Gudrun Ziegler gibt Sprachförderung an Schulen und hilft Kindern bei den Hausaufgaben.
Können Sie den Weg einiger Mädchen über eine längere Zeitspanne hinweg überblicken? Welche Entwicklung nehmen die Kinder?
Gudrun Ziegler erzielt mit ihrer Arbeit eindrucksvolle Erfolge in der Schule. Sie betreut insgesamt 30 Mädchen im Schuljahr. Die Noten der Schülerinnen verbessern sich, die Mädchen beginnen, sich mit ihrer eigenen beruflichen Perspektive zu beschäftigen, manche studieren. Immer mehr Mädchen besuchen die Realschule und das Gymnasium. Es ist wunderbar, das zu sehen.
Ist es für Ihre Stiftung in den vergangenen Jahren einfacher oder schwerer geworden, mit Mädchen aus diesem Kulturkreis zu arbeiten, die Unterstützung benötigen?
Diese Mädchen haben eher wenig Kontakte zu Gleichaltrigen, die integriert sind. Etliche Familien versuchen, die Berührungspunkte der Kinder zur Gesellschaft aus Angst vor falscher Beeinflussung weitgehend einzuschränken. Die Rückwendung zu einer starren, formalistischen Religionsauffassung hat zugenommen. Und das beunruhigt mich.
Ist das Thema „Elternbildung“ überhaupt erwünscht?
Man muss sagen, dass Frauen zwar häufig offen für solche Angebote sind und auch Interesse an einer Ausbildung haben, aber nicht alle Ehemänner lassen das zu.
Müssen sich muslimische Mädchen letztlich für eine der beiden Kulturen entscheiden?
Ideal wäre es, sie könnten an beiden Kulturen gleichmäßig teilhaben. Die Geborgenheit der Familie möchten sie natürlich nicht aufgeben, wohl aber die Bevormundung. Dass jemand quasi aus diesem Verbund ausbricht, kommt selten vor – es ist gewiss nicht einfach. Bei jungen Frauen aus dem Kosovo ist es aber wiederum leichter als bei türkischstämmigen Frauen, weil man im Kosovo einen liberaleren Islam pflegt.
Im Zusammenhang mit den in Deutschland lebenden Flüchtlingen wird allenthalben davon gesprochen, dass deren Integration nicht misslingen darf. Sehen Sie genügend Angebote von staatlicher Seite?
Jedenfalls wird heute sehr deutlich, dass die vor vielen Jahren nach Deutschland gekommenen Migrantinnen nur sehr wenige Möglichkeiten hatten, die Sprache zu lernen. Das Ergebnis ist, dass in manchen Fällen Frauen nach 20 Jahren noch nicht auf deutsch sagen können, wie sie heißen. Dass sie sich deshalb ausschließlich in ihren Kreisen bewegen, liegt auf der Hand. Immerhin sind die heutigen Angebote im Vergleich zu damals sehr umfangreich.
Was ich aber ebenfalls für wichtig halte, sind neue Wege, um den Frauen etwa den Hauptschulabschluss oder eine Ausbildung zu ermöglichen. Ich fände es beispielsweise richtig, diesen Frauen eine Ausbildung in Teilzeit anzubieten, weil sie sich zuhause um die Kinder kümmern müssen.
Inwieweit beschäftigt sich die Stiftung mit den Flüchtlingen vor Ort?
Dadurch hat sich unsere Arbeit deutlich ausgeweitet. Wir haben drei zusätzliche Mitarbeiterinnen: Shkila Paynda hat sich rührend um die Menschen aus Afghanistan gekümmert – als Frau, die beide Welten kennt. Annette Windhausen und Hanna Otter engagieren sich für die Themen Sprachförderung und Sprachkurse. Annette Windhausen hilft zudem afghanischen Jungen, die alleine nach Lörrach gekommen sind. Das alles ist eine enorme Herausforderung, bei der wir mitunter auch an Grenzen stoßen. Wir übersetzen beispielsweise nicht die Gespräche von traumatisierten Patienten.
Und: Früher waren diese Menschen ja vor Ort alle beieinander, mittlerweile leben sie im ganzen Landkreis. Das Flüchtlingscafé hat sich zu einer wichtigen Anlaufstelle entwickelt.
Schon im August 2015 haben Sie sich im Gespräch mit unserer Zeitung besorgt gezeigt über die Entwicklung des muslimischen Lebens in Lörrach. Mittlerweile hat sich vieles getan, unter anderem in der Türkei. Wie hat sich die Lage in Ihrer Wahrnehmung in Lörrach entwickelt?
Sagen wir so: Wir beobachten mittlerweile, dass selbst Türken untereinander vorsichtiger werden, weil sie nie wissen, was nach außen getragen wird. Jedenfalls gibt es auch innerhalb der türkischen Gemeinschaft Spannungen zwischen Liberalen und Konservativen. Dass sich bei der Wahl der Internationalen Kommission keine einzige Person aus der Türkei zur Wahl gestellt hat, sagt auch etwas aus.
Hat die laute, mitunter aggressive Debatte mit der Türkei die gemäßigten Muslime in Deutschland zu sehr in den Hintergrund gedrängt?
Auf jeden Fall. Leider haben die gemäßigten Muslime viel zu wenig Unterstützung erfahren. Wer am lautesten schreit, wird wahrgenommen. Die liberalen Muslime wünschen sich sehr, dass man ihre Stimme stärker wahrnimmt – übrigens auch in Frankreich und Nordafrika. Diese Menschen gibt es in großer Zahl, aber sie können sich nur unzulänglich Gehör verschaffen.
Warum hat Erdogan in Deutschland so viele leidenschaftliche Unterstützer? Auch unter völlig unauffällig lebenden Türken, die alle Möglichkeiten unserer demokratischen Gesellschaft in Anspruch nehmen können und gleichzeitig einem Präsidenten zujubeln, der in der Türkei demokratische Strukturen aushöhlt? Das befremdet viele Deutsche.
Erdogan gibt seinen Landsleuten ein hohes Maß an Selbstbewusstsein. Dieses Angebot hat eine große Sogwirkung auf viele türkische Bürger. Gerade deshalb, weil sie sich noch immer in der Defensive fühlen, noch immer nicht richtig akzeptiert. Erdogan gibt ihnen ein Gefühl der Stärke.
Was sagt das über das Leben dieser türkischen Mitbürger in Deutschland aus?
Es ist natürlich schwierig, wenn man in einem Land Fuß fassen soll, das einen anderen kulturellen Hintergrund hat, in dem Barrieren überwunden werden müssen. Darunter mögen Hürden sein, die nur genommen werden können, wenn man bereit ist, seine frühere Identität wenigstens ein Stück weit aufzubrechen – das bedeutet keineswegs, sich selbst aufzugeben. Es ist und bleibt in vielen Fällen ein Bildungsproblem. Sprache und Bildung bleiben der Schlüssel zur Integration.
Was könnte von deutscher und türkischer, beziehungsweise muslimischer Seite getan werden, um besser miteinander ins Gespräch zu kommen?
Schwierig. Es gibt keine einfache Lösung. Was die offizielle Schiene angeht, bin ich offen gestanden etwas ratlos. Der Dialog kann eigentlich nur auf der persönlichen Ebene, an der Basis verbessert werden. Wir müssen uns zuhören, tolerant sein, akzeptieren, dass Menschen einen anderen Glauben haben. Aber wir müssen auch unsere eigenen Überzeugungen vertreten, deutlich machen, was uns an unserer Kultur wichtig ist. Wenn wir das klar sagen, dann, so denke ich, wird das auch akzeptiert. Menschen mit Migrationshintergrund sollten wissen, welche Regeln sie hier einhalten müssen. Dazu gehört, dass wir selbst eine klare, reflektierte Haltung zu unseren Werten einnehmen. Wer grundlegende Rahmenbedingungen unseres gesellschaftlichen Miteinanders nicht akzeptieren möchte, der sollte sich nach meiner Auffassung gegen ein Leben in unserem Land entscheiden.
Was motiviert Sie, Ihre Arbeit weiterzuführen?
Dass wir immer wieder sehen, wie wir Frauen helfen können, wie sich Mädchen entwickeln, ihre Möglichkeiten erweitern, wie sie die Basis für ein eigenständiges Leben schaffen. Dass sich diese Frauen bei uns wohl fühlen und spüren, dass sie Teil der Gesellschaft sind und etwas zu dieser beitragen können. Um ein Beispiel zu nennen: Ein von uns begleitetes Mädchen hat Betriebswirtschaft studiert. Diese junge Frau kommt aus dem Kosovo und hat eines Tages bei uns angefragt, wie sie der Gesellschaft etwa zurückgeben kann, wie sie sich ehrenamtlich engagieren kann. Das ist doch wunderbar und sehr ermutigend!
Wir sehen an unserem Gespräch, dass sich etliche Fragen im Dialog umkreisen, aber nicht eindeutig beantworten lassen. Aber wir können mit der Stiftung konkrete Angebote machen für ein besseres Zusammenleben. Dass diese Angebote angenommen werden, ist eine große Freude für uns.
Meist geklickt
Beilagen
Umfrage