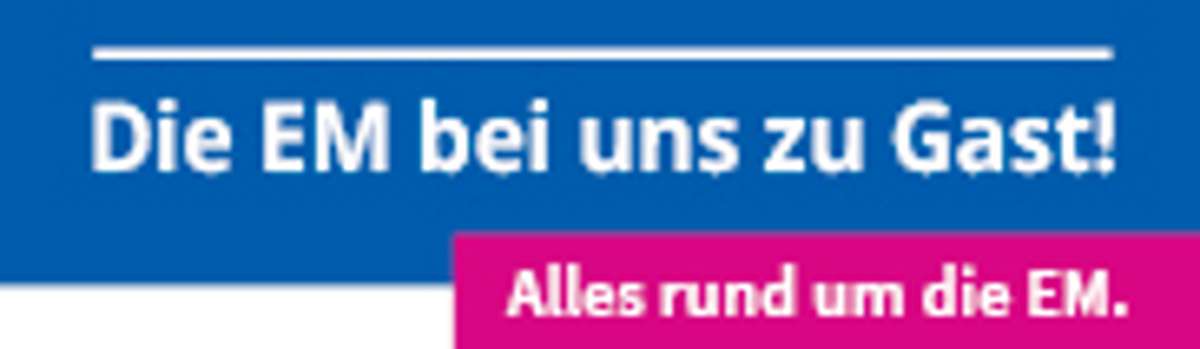Lörrach - Leicht hatte es Kultur nie. Mit Corona jedoch gerieten viele Kulturschaffende und Veranstalter in eine zuvor undenkbare Krise. Betroffen sind indes nicht nur die von Existenznöten bedrohten „Profis“. Auswirkungen haben Proben- und Veranstaltungsausfälle auch für Laien. Wie ein renommierter und geschätzter Klangkörper wie das Oberrheinische Sinfonieorchester Lörrach damit umgeht, wollte Gabriele Hauger von dessen musikalischem Leiter Stephan Malluschke wissen.
Interview: Stephan Malluschke über das Oberrheinische Sinfonieorchester in Corona-Zeiten
Am meisten in Verruf sind wohl die Bläser gekommen – als Virenschleuder. Wie schnell hat ihr Orchester auf die Corona-Entwicklung reagiert und mit welchen Maßnahmen?
Sie formulieren durchaus richtig: „in Verruf gekommen“. Ist es doch gar nicht sicher, ob infektiöse Aerosole durch Blasinstrumente wirklich so gravierend Verbreitung finden. Neuere Untersuchungen scheinen das teilweise eher zu verneinen. Da hatte es das Oberrheinische Sinfonieorchester mit seinem Stamm von Streichinstrumenten leichter, wieder in einen Probenmodus zu kommen. Nach Pfingsten konnten wir mit einem strengen Hygienekonzept wieder in unsere Mittwochsproben im Haus der Stadtmusik in Lörrach einsteigen.
Das gemeinsame Proben ist identitätsstiftend und wichtig. Kann man das – beispielsweise online – einigermaßen kompensieren?
Proben online? Wie soll das gehen? Nein, das Erarbeiten komplexerer Musikwerke, das geht nur analog und braucht das unmittelbare Klangerlebnis, welches dann korrigierend gestaltet werden muss. Gerade beim Laienmusizieren geht es um Kontinuität unter ständiger gegenseitiger Reflexion, damit man am Werk und dessen Anforderungen wachsen kann, seine persönlichen Grenzen ständig erweitern und das Ergebnis auf Aufführungsniveau gebracht werden kann. Dabei ist das, was Sie ansprechen, natürlich ganz wichtig: die identitätsstiftende Komponente, mit dem Werk und im Ensemble untereinander.
Wie ist die Stimmung unter den Musikern: Pessimismus, Hoffnung, Gelassenheit?
Musik und Musizieren hat immer auch was mit positiver Daseinseinstellung und Hoffnung zu tun. Nach den vielen Wochen des Probenausfalls und der Absage unserer Sommerkonzerte war sicherlich beim einen oder anderen die Stimmung etwas gedrückt.
Aber kaum durften wir wieder proben, war da eine unglaubliche Erleichterung und Freude bei allen Orchestermitgliedern zu spüren. Diesen Hoffnungszuwachs haben wir genutzt, um in sechs Proben das Programm für unser Burghofkonzert, ein groß besetztes spätromantisches „englisches“ Programm mit Vaughan-Williams, Elgar und Mendelssohns „Schottischer Sinfonie“, in Angriff zu nehmen.
Inwieweit wurde über die Wochen und Monate Kontaktpflege unter den Orchestermitgliedern praktiziert, und wie wichtig ist dies für die Zukunft des Klangkörpers?
Den Grad der Kontaktpflege der einzelnen Orchestermitglieder untereinander kann ich nur erahnen. Von offizieller Seite des Orchesters aus waren dafür der Orchestervorstand und die Mitglieder des Orchesterrats zuständig, wofür diesen überaus engagierten gewählten Gremiumsmitgliedern mein allergrößter Dank gilt. Hier ist vor allem unsere zweite Vorsitzende Gabriele Staufenbiel zu nennen, die neben anderen maßgeblich daran gearbeitet hat, dass der Probenbetrieb nach Pfingsten wieder möglich wurde.
Ich hoffe natürlich, dass es nicht wieder zu einem totalen coronabedingten Herunterfahren das öffentlichen Lebens kommen muss, denn der regelmäßige musikalisch-menschliche Kontakt ist natürlich auch für den Fortbestand eines Ensembles wie das Oberrheinische Sinfonieorchester von existenzieller Bedeutung.
Was bedeutet Corona für Sie als Musiker, Mensch und Musikkonsument persönlich?
Als durch Corona quasi „zwangsentschleunigter“ Mensch hatte ich die Möglichkeit, einmal tiefer darüber nachzudenken, oder zu erleben, was mir im Leben eigentlich wichtig ist. Da war es wichtig, familiär harmonisch eingebettet zu sein, hier in Malsburg in natürlicher, ländlicher Umgebung leben zu können mit sauberem Wasser vom Blauen und sauberer Luft ohne Kondensstreifen über sich. Da hatte ich schon auch das Gefühl, privilegiert zu sein. Aber schnell war da auch ein Gefühl des Entzugs, denn die lebendige Musik und das Musizieren mit dem Orchester fehlten mir. Und: Wie gerne würde ich mal wieder ein großes Konzert als gemeinschaftliches Erlebnis inmitten eines voll besetzten Konzertsaales besuchen.
Ich glaube, das geht vielen Menschen in dieser Zeit so. Schließlich braucht auch die Seele Nahrung, und das ist die Kunst, allen voran die Musik. Als jemand, der zum Glück durch sein Musizieren nicht seinen Lebensunterhalt verdienen muss, sind dabei meine Gedanken oft bei denjenigen Kolleginnen und Kollegen, denen durch die Pandemie und die damit verbundenen Auftrittsabsagen wirtschaftlich regelrecht der Boden unter den Füßen weggebrochen ist. Da kann ich nur hoffen, dass die versprochenen staatlichen Hilfen ein unbürokratisches soziales Netz bilden können.
Glauben Sie, dass der lange Verzicht auf live-Konzerte bei den Menschen die Wertschätzung für Musiker und andere Kulturschaffende steigen lässt? Dass Corona also im Kulturbereich vielleicht sogar etwas Positives bewirken kann?
Ich glaube, dass heute im Vergleich zu früheren Zeiten sicher schon eine sehr hohe Wertschätzung gegenüber den Kulturschaffenden gelebt wird. Die hohe Wertschätzung des Publikums sieht man schon daran, dass jetzt viele das Eintrittsgeld abgesagter oder verschobener Konzerte spenden oder die Karte aufheben für den Nachholtermin. Das betrifft aber leider nur die großen Veranstaltungen und großen Häuser. Die werden überleben. Meine Sorge gilt der sogenannten „Kleinkunst“, die ja oft die Fläche und die eher ländlichen Regionen kulturell versorgt. Hier wird leider viel verschwinden durch Corona.
Wie und was planen Sie für die Zukunft?
Tja, nachdem wir im Orchester hoffnungsvoll in den letzten Proben das erwähnte „englische Programm“ geprobt haben, hat sich die Situation wegen der Beibehaltung der strengen Hygienevorschriften über den Herbst hinaus schon wieder geändert. Eine so große Besetzung von an die 70 Musikerinnen und Musikern mit zu wenig Platz auf der Bühne bei hohen Honorarkosten und kontigentiertem Kartenverkauf kann so nicht verwirklicht werden. Wir schwenken mit einer nur kleinen Programmvariante um auf das ausgefallene Sommerprogramm. Dabei handelt es sich um ein reines Streicherprogramm mit Werken von Grieg, Warlock, Bartók und Janácek, und wir finden somit bei den strengen Abstandsregeln auf der Bühne alle Platz. Die Koordinierung in den Registern und als Gesamtheit wird hierbei eine verstärkte Herausforderung für mich als Dirigenten sein.
Wenn Corona vorbei ist: Was wünschen Sie sich dann für Ihr Orchester, von welchem Auftritt und welchem Programm träumen Sie?
Das ist für mich klar: das ursprünglich geplante Burghof-Programm möglichst nachholen zu können. Haben wir doch die Chance, mit der Mezzosopranistin Tanja Baumgartner, die gerade bei den Salzburger Festspielen und nächstes Jahr an der Wiener Staatsoper verpflichtet ist, in den „Sea-Pictures“ von Edvard Elgar eine Solistin aus der allerersten Riege der internationalen Gesangsstars als unseren Gast begrüßen zu dürfen. Um so schöner, dass Tanja regionale Wurzeln hat, denn sie stammt aus Rheinfelden.
Meist geklickt
Beilagen
Umfrage