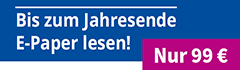Lörrach/Balingen - Abgeräumt haben gestern fünf Jungforscher beim Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“ in Balingen (Zollernalbkreis). Zwei erste Preise, einen zweiten sowie einen Sonderpreis gab es für die drei Projekte, die allesamt am Schülerforschungszentrum Phaenovum entstanden sind.
Phaenovum-Forscher bei Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“ in Balingen erfolgreich.
Mit einem Landessieg im Fachbereich Mathe wurden Verona Miftari (13) und Florian Bauer (12) belohnt. Das Duo beschäftigte sich mit Brüchen. Beide besuchen das Hans-Thoma-Gymnasium (HTG). Dort wurde für dieses Schuljahr das naturwissenschaftliche Profilfach IMP, kurz für Informatik, Mathematik und Physik, eingeführt. Verona und Florian zählen zum ersten Teilnehmer-Jahrgang. „Wir waren neugierig und haben uns deshalb angemeldet“, sagte Verona gestern. Und beiden machte der Inhalt Spaß, so dass ihr Lehrer und späterer Projektbetreuer Pirmin Gohn auf sie zu kam und ihnen das Projekt vorschlug.
Die Gymnasiasten wollten herausfinden, ob man die Periodizität von Brüchen voraussagen kann. Denn, so lautete die These und Beobachtung, gerade lange Perioden machen das Rechnen mit Dezimalzahlen aufwendig, hingegen rechnen viele Menschen ungern mit Brüchen.
Also legten sie Tabellen an, um Auffälligkeiten zu finden und kamen zum Schluss, dass bei bestimmten Zahlen, Brüche nicht periodisch werden. Verona: „Wenn in der Primfaktorzerlegung des Nenners andere Zahlen als Zweien oder Fünfen auftauchen, ist die Zahl periodisch.“ Praktisches Beispiel: der Bruch eins durch 44. Die Primfaktorzerlegung für den Nenner lautet zwei mal zwei mal elf. Wegen der Elf wird die Dezimalzahl periodisch.
Zahlen bildeten bei ihm zwar keinen Schwerpunkt, spielten aber dennoch eine Rolle: Julian Kehm fragte sich, ob die Venusfliegenfalle zählen kann. Auf die Idee brachte ihn ein Artikel, den er im Internet gelesen hatte. In diesem wurde die Behauptung aufgestellt, dass sich die Venusfliegenfalle nach dreimaliger Berührung schließt.
Erst beim Einsatz zerquetschter Fliegen klappte es
Das Interesse des 13-Jährigen war geweckt. Zunächst probierte er es mit lebenden Fliegen, mit mäßigem Erfolg. Erst beim Einsatz zerquetschter Fliegen klappte es, erzählte er. Seine Vermutung: es könnte am Protein liegen: „Venusfliegenfallen wachsen auf nährstoffarmen Böden und benötigen deshalb Eiweiß.“ Und siehe da: auch als er mit pflanzlichem Eiweiß seine Versuche wiederholte, klappte es mit dem Zählen. Damit erreichte Julian den Sieg im Fachbereich Biologie.
Gleich doppelt abgeräumt haben Adam Muderris (15) und Frank Würthner (14) vom HTG. Sie gingen mit dem Radio auf Meteorenjagd und erhielten für ihr Projekt im Fachbereich Physik einen zweiten Preis sowie den Sonderpreis Rundfunk-, Fernseh- und Informationstechnik, der mit 150 Euro dotiert ist und von der Eduard-Rhein-Stiftung gestiftet wurde.
Das Prinzip dahinter: Meteore erzeugen Ionisierungskanäle beim Eintritt in die Erdatmosphäre in rund 100 Kilometern Höhe. Freie Elektronen reflektieren diese Radiowellen und diese wiederum können mit einer Antenne aufgenommen werden. Adam und Frank haben sich eine Yagi-Antenne gebastelt und mal hingehört. Adam erklärte den Vorteil an dieser Methode: „Man kann rund um die Uhr messen und ist unabhängig vom Wetter.“
Die Aufzeichnung geschah digital auf einem Laptop. 150 Gigabyte an Daten hatten sich innerhalb eines Monats angesammelt. Während dieser Zeit haben die beiden 10 000 Meteore „gehört“. Das auch deshalb, weil in die Beobachtungszeit die Geminiden und die Quadrantiden fielen, zwei Sternschnuppenschauer.
Doch auch von der Uhrzeit ist es abhängig, ob es viele oder wenige Meteore gibt. Frank: „ Morgens um 5 Uhr hört man die meisten.“
Meist geklickt
Beilagen
Umfrage