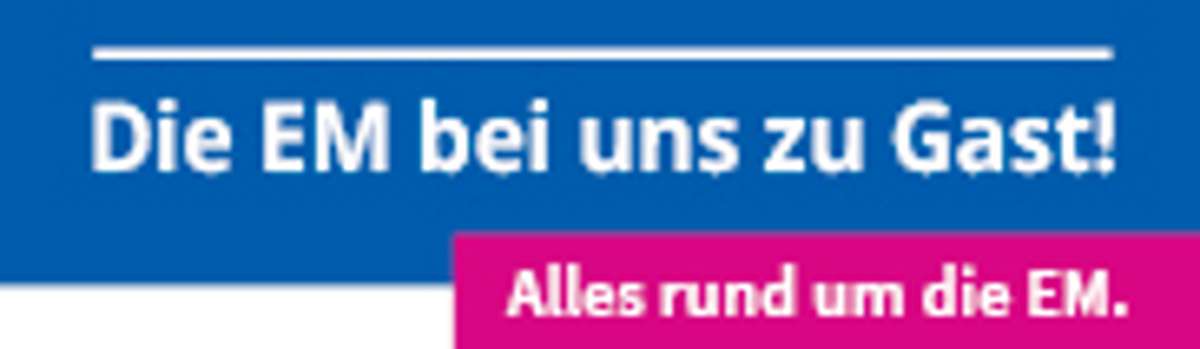Weniger als Verkehrsdrehscheibe, sondern als fast schnurgerade Lebensader ist die 4,2 Kilometer lange Weiler Hauptstraße zu betrachten. Bereits im 17. Jahrhundert war zu lesen, dass die Bauern der kleinen Gemeinde Weil, direkt am Tüllinger Berg gelegen, auf geradem Weg zum Rhein fuhren, um in Fronarbeit die Friedlinger Matten zu bewirtschaften.
Die Hauptstraße durchzieht als schnurgerade Lebensader Weil am Rhein. Hier lässt sich die Weiler Geschichte entlang zentraler Wegmarken studieren.
Eisenbahnbau war großer Einschnitt
Als Mitte des 19. Jahrhunderts die Bahn von Karlsruhe bis Basel gebaut wurde, gab das einen großen Einschnitt. Von da an mussten die vier Gleisstränge über eine Furt an der Stelle des heutigen Obelisk-Kreisels an der B 3 überquert werden. Erst 1908, als die Bahn weitere Gleise verlegte, wurde als direkte Verbindung nach Friedlingen wieder eine Eisenbahnbrücke gebaut. Es liegt also vermutlich in der DNA der Weiler, dass sie die direkte Verbindung vom heutigen Alt-Weil an den Rhein so vehement verteidigen.
„Schöne gerade Straßen, freie Plätze, schattige Baumreihen“
Als vor etwa 100 Jahren das Dorf Weil durch Zuzug auf über 6000 Bewohner angewachsen war und die Bebauung an der heutigen Hauptstraße Richtung Westen sukzessive weiter wuchs, wurde die Erhebung zur Stadt beantragt. Noch bevor dies mit der endgültigen Namensgebung „Weil am Rhein“ zustande kam, schrieb die „Freiburger Zeitung“ am 17. Februar 1929 in einem Artikel mit dem Titel „Das zukünftige Groß-Weil“: Die Stadt würde durch Zuzug und Industrie in den nächsten Jahren sehr stark anwachsen, und der Bebauungsplan auf der Leopoldshöhe wäre nach den neuesten Regeln für den Städtebau aufgestellt. Weiter ist von schönen geraden Straßen, von freien Plätzen, die dem Auge eine angenehme Abwechslung bieten und kleinen Vorgärten, sowie schattigen Baumreihen zu lesen.
Das Tanzlokal Trocadero – eine Legende des Nachtlebens
Was Plätze anbetrifft, so sei hier besonders der in den 1950er- und 1960er-Jahren überregional unter Nachtschwärmern bekannte „Trocaderoplatz“ erwähnt, heute Rathausplatz 5 (Alnatura). Der hatte seinen Namen von dem 1956 von Wolfgang Zimmermann eröffneten Tanzlokal „Trocadero“ im Keller an der Leopoldstraße 2a, wo früher das „Kaufhaus für Alle“ seinen Sitz hatte.
Eine wahre Erfolgsgeschichte des „Troc“ begann, als er den Oberkellner Charly Bierau einstellte. In dem damals einzigen Lokal mit Nachtkonzession wurde bis in die frühen Morgenstunden getanzt und gefeiert. Abgestellt wurden die Autos auf dem gegenüber der Hauptstraße freien Platz. Noch, als 1964 das Rathaus gebaut wurde, stand oftmals morgens noch ein verlassenes Fahrzeug im Wege.
Da Bierau nur nachts arbeitete, suchte er eine Beschäftigung für tagsüber. Die fand er, indem er den von seinem Schwager Eugen Wegeler an diesem inoffiziellen Parkplatz betriebenen Kiosk pachtete.
Begründer der Weiler Kiosk-Kultur
Bis 1967 verkaufte er mit seiner Frau dort neben Zeitschriften auch Obst, Reiseandenken, Lebensmittel und Reiseutensilien. Danach wurde der äußerst günstig an der Hauptstraße gelegene Kiosk von der Firma Hapke übernommen. Offensichtlich zu eilig hatte es einmal ein Fahrzeug in den 70er-Jahren.
Oder er hatte nicht richtig verstanden, was „Drive-In“ wirklich bedeutet. Optik Burkart schmückte damals sein Schaufenster mit dem Foto und dem Hinweis „mit Brille wär es nicht passiert“.
Meist geklickt
Beilagen
Umfrage