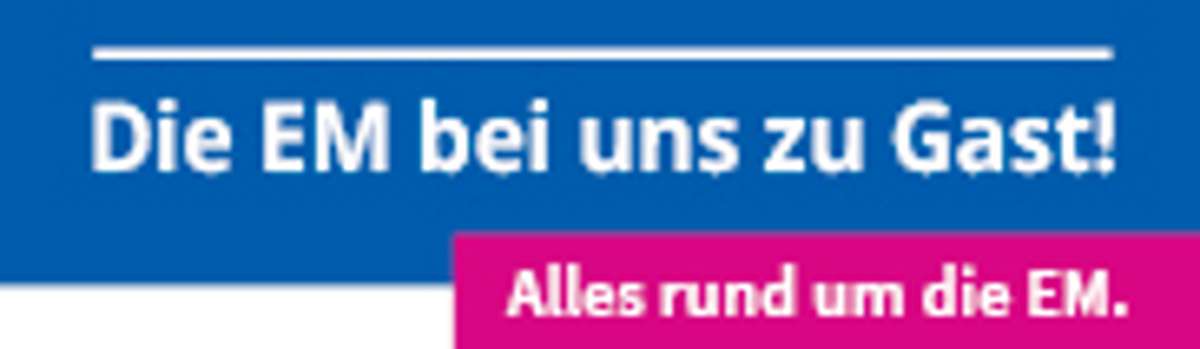Jahrzehntelang haben Kunststoffe die Vorstellungskraft von Designern und Architekten beflügelt, sie standen für unbeschwerten Konsum und revolutionäre Neuerungen. Doch diese Zeiten sind vorbei, denn die Folgen des Kunststoff-Booms sind drastisch sichtbar geworden. Mit der großen Ausstellung „Plastik. Die Welt neu denken“ untersucht das Vitra Design Museum in Weil am Rhein die Geschichte, Gegenwart und Zukunft eines kontroversen Materials. Die Ausstellung ist vom 26. März bis 4. September zu sehen.
Plastik: Ausstellung des Vitra Design Museums, V&A Dundee und maat, Lissabon, ab dem 26. März
Weil am Rhein. Zum Auftakt der Ausstellung veranschaulicht eine großformatige Filminstallation, welche Konflikte sich aus der Produktion und Nutzung von Plastik ergeben. Zeitlosen Szenen urwüchsiger Natur stehen Filme über die Kunststoffproduktion der letzten 100 Jahre gegenüber, die die Verlockung einer immer schneller getakteten und günstigeren industriellen Herstellung deutlich machen, heißt es in der Ankündigung
Der zweite Abschnitt der Ausstellung führt durch die Geschichte der Kunststoffe von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Er beginnt mit einem Rückblick auf wichtige Vorläufer, von denen viele noch auf pflanzlichen und tierischen Rohstoffen basierten. So besteht das einst für Dekorationsobjekte und Seekabelisolierungen verwendete Guttapercha aus dem eingedickten Saft des gleichnamigen Baumes, während Schellack für die ersten Schallplatten aus den Ausscheidungen der Schildlaus gewonnen wurde.
Kunststoffe zogen in den Haushalt ein
Während die ersten Kunststoffe oft von einzelnen Erfinderpersönlichkeiten entwickelt wurden, nahm ab den 1920er-Jahren die rasch wachsende petrochemische Industrie eine führende Rolle ein. So begann eine Epoche, die die Ausstellung unter dem Begriff der „Petromoderne“ zusammenfasst. Auch der Zweite Weltkrieg trieb die Entwicklung von Kunststoffen voran – so wurden etwa Plexiglas für Flugzeugcockpits und Nylon als Material für Fallschirme erstmals in großem Maßstab verarbeitet.
Nach 1945 zogen diese Materialien in den Haushalt ein, etwa in Form von Plastikgeschirr und Tupperware, Spielzeug wie Lego und Barbie oder den beliebten Nylon-Strumpfhosen. Mit der zunehmenden Faszination für die Raumfahrt rückte einige Jahre später das utopische Potenzial von Plastik in den Vordergrund, das sich in futuristischen Formen und neuen Wohnkonzepten widerspiegelte. Beispiele in der Ausstellung sind Eero Aarnios „Ball Chair“ (1963), Gino Sarfattis „Moon Lamp“ (1969) oder das „Toot-a-Loop“ (1971) – ein Radio, das als Kunststoffarmreif getragen wurde.
Designer wie Jane Atfield zählten in den 1990er-Jahren zu den Ersten, die mit recycelten Kunststoffen arbeiteten und daraus eine neue Ästhetik ableiteten. Dies lenkte den Blick auch darauf, dass Plastik nicht gleich Plastik ist.
Was muss sich ändern? Wie können wir die globale Plastikmüllkrise bewältigen? Welche Rolle kann dabei – neben Industrie, Politik und Konsumenten – das Design spielen? Diesen Fragen widmet sich der dritte Teil der Ausstellung. Hier werden Projekte wie „The Ocean Clean Up“, „Everwave“ und „The Great Bubble Barrier“ vorgestellt, die Plastikabfälle aus Flüssen und Weltmeeren filtern sollen.
Doch die Reduktion von Plastikabfall muss viel früher beginnen, etwa mit der Vermeidung überflüssiger Verpackungen und Einwegprodukten sowie einem Designansatz, der den gesamten Lebenszyklus eines Produkts und der dafür verwendeten Materialien berücksichtigt. Ein Beispiel ist der „Rex Chair“ (2011/2021) von Ineke Hans, den der Hersteller nach Gebrauch gegen Pfand zurücknimmt, falls möglich repariert und ansonsten recycelt.
Dem Thema Recycling ist ein eigener Ausstellungsbereich in der Vitra Design Museum Gallery gewidmet. Hier können die Besucher in einem interaktiv angelegten Raum Recycling-Kreisläufe kennenlernen und das Projekt „Precious Plastic“ (seit 2013) des niederländischen Designers Dave Hakkens erleben.
Beispiel für „Bioplastik“
Ähnlich wie in der Frühzeit der Kunststoffe arbeiten heute wieder viele Forscher und Designer an Materialien, die nicht aus fossilen, sondern aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen, besser abbaubar sind und oft als Bioplastik bezeichnet werden. Als Beispiele zeigt die Ausstellung Experimente mit Algen der holländischen Designer Klarenbeek & Dros oder Forschungen zu Myzelien (Pilzzellen) des Karlsruhe Institute of Technology.
Meist geklickt
Beilagen
Umfrage